SDIKA: Eine sichere digitale Identität für Karlsruher*innen
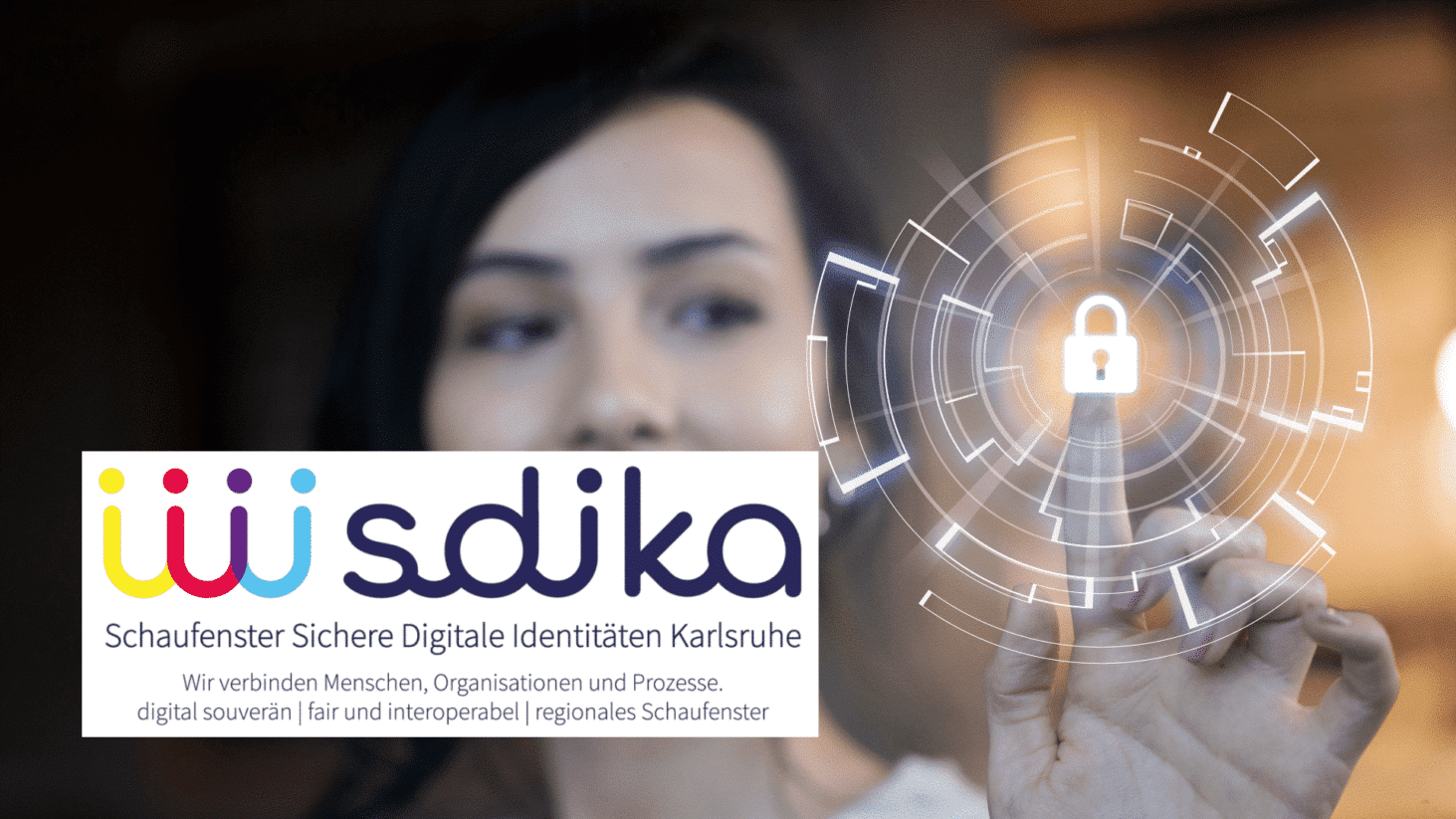
Sichere, digitale Identitäten sind der Schlüssel zur digitalen Transformation, da in ihrem Mittelpunkt die Nutzer*innen beziehungsweise deren Daten stehen. Wie das aussehen könnte, erforscht das Projekt „Schaufenster Sichere Digitale Identitäten Karlsruhe“ (SDIKA).
Die digitale Transformation hat unser tägliches Leben in vielerlei Hinsicht verändert, sei es in der Art und Weise, wie wir einkaufen, kommunizieren oder arbeiten. Diese Veränderungen haben auch den Bedarf an sicheren, digitalen Identitäten verstärkt. Denn in einer Welt, in der die meisten Aspekte unseres Lebens online stattfinden, braucht es Lösungen, die die unkomplizierte, barrierefreie Nutzung digitaler Dienstleistungen erlauben, die aber zugleich unsere persönlichen Daten schützen.
„Digitale Identitäten ermöglichen in der Gesellschaft ganz neue Prozesse, die es so zuvor nicht gab. Wenn man so will, fungieren sie als Bindeglied zwischen der Bürgerschaft und den einzelnen digitalen Anwendungen,“ erklärt Sascha Alpers, der am FZI Forschungszentrum Informatik für das Projekt SDIKA verantwortlich ist. „Es gibt zwar schon seit einigen Jahren den Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, aber die Hürden, um diesen auch tatsächlich zu nutzen, sind hoch. Wir wollen eine Lösung schaffen, die für die Bürger*innen so einfach nutzbar ist, wie das Bezahlen mit einer EC-Karte oder dem Smartphone.“
SDIKA: Alltagstauglichkeit wird großgeschrieben

Die Souveränität der Nutzer*innen – das können neben der Bürgerschaft auch Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Vereine sein – steht bei SDIKA im Vordergrund. Sie entscheiden beispielsweise selbst, ob sie ihre Identitäten zentral (Cloud-based-Identity) oder selbst (Self Sovereign Identity, SSI) verwalten, auch welche Daten sie überhaupt mit Dritten teilen.
Darüber hinaus stehen Interoperabilität, Offenheit und Alltagstauglichkeit im Fokus des Projekts. Unter anderem wird es ein Open-Source Adapter ermöglichen, die digitalen Identitäten verschiedener Ausgabestellen in unterschiedlichen Anwendungsfällen zu nutzen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass die digitalen Identitäten überhaupt genutzt werden und offene, digitale Ökosysteme entstehen können.
„Im Rahmen von SDIKA sollen alltägliche und relevante Anwendungsfälle aus den Bereichen E-Government, Gesundheit, Mobilität, Digitales Planen und Bauen sowie Digitale Stadtgesellschaft erprobt werden, die dann perspektivisch mit einer anwendungsfallübergreifenden eID genutzt werden können,“ erläutert Sascha Alpers. „Darüber hinaus können wir auch spezifische Identitätsattribute berücksichtigen, etwa den digitalen Nachweis eines Führerscheins. So lassen sich dann auch Carsharing-Angebote nutzen.“
Dabei gilt stets der Grundsatz der Datensparsamkeit: Es werden immer nur die Informationen mit den Anbietern geteilt, die für die jeweilige Dienstleistung benötigt werden. Bei der Anmietung eines Autos erfährt der Carsharing-Dienst beispielsweise nur, ob ein Führerschein der Klasse B vorhanden ist, nicht aber, ob auch noch eine weitere Fahrerlaubnis in einer anderen Klasse vorhanden ist.
SDIKA: Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung arbeiten Hand in Hand

„Ein weiteres Beispiel zur Nutzung der digitalen Identität wäre ein Besuch im Karlsruher Zoo. Das dafür notwendige Ticket lässt sich dann einfach und komfortabel über die Karlsruhe.App buchen, etwaige Rabatte, die sich beispielsweise aus einer vorhandenen CIK-club-Card ergeben, werden direkt berücksichtigt,“ erzählt Wolfgang Toppazzini vom Amt für Informationstechnik und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe, die zugleich SDIKA-Konsortialführer ist. „SDIKA hilft uns aber auch dabei Verwaltungsleistungen zu digitalisieren, sodass kein Medienbruch mehr stattfindet und die Bürger*innen alles online erledigen können.“
Ursprünglich vom FZI Forschungszentrum Informatik initiiert, ist SDIKA inzwischen ein Projekt, an dem über 20 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung Hand in Hand arbeiten. Bis Ende des Projektzeitraums im August 2024 sollen über 10 Anwendungsfälle für Karlsruhe und die Metropolregion Rhein-Neckar realisiert werden – stets mit dem Ziel der digitalen Souveränität sowie der Interoperabilität der unterschiedlichen Lösungen. „Aber auch der Aspekt der Usability ist uns sehr wichtig, denn nur was einfach nutzbar ist, wird auch genutzt. Wir haben deshalb schon früh Testballons mit ausgewählten Bürger*innen gestartet,“ betont Sascha Alpers.

SDIKA ist derweil nicht das einzige Projekt seiner Art in Deutschland: „Auch in anderen Städten und Regionen wird an sicheren, digitalen Identitäten geforscht,“ ergänzt Markus Losert, der das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe leitet. „Natürlich stehen wir mit diesen Projekten in regelmäßigem Austausch, um technologische Überschneidungen und Synergien zu nutzen. Denn am Ende sollen die digitalen Identitäten ja nicht nur in einer bestimmten Stadt oder Region funktionieren.“
Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen SDIKA-Projektseite.